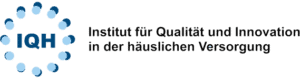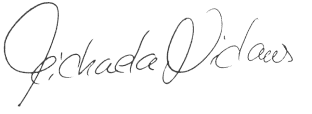Einfach, unkompliziert und schnell
Help4Seniors hat sich bereits seit 2006 auf die deutschlandweite Vermittlung von „24-Stunden-Pflege und Betreuung“ durch polnische / osteuropäische Betreuungskräfte spezialisiert. Durch die gezielte Unterstützung im Alltag können hilfsbedürftige Menschen in ihrem geliebten Zuhause bleiben und haben wieder mehr Freude am Leben.
Unser oberstes Ziel ist Ihre Zufriedenheit. Wir bleiben Ihre Ansprechpartner und sind auch im Notfall stets erreichbar.